| Transdisziplinäre Plattform künstlerischer und kultureller Beiträge zum Globalbewusstsein | ||
| Jetzt-zeichnen-AG |
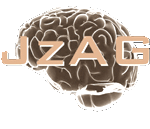 |
ORBANIC
STADT UND URBANITÄT IN ZUKUNFT UND HEUTE
| ESSAYS | URBAN BODIES | CHAOS STADT |
ZU URBANISMUS, STÄDTEBAU UND GESELLSCHAFT
|
ESSAYS
|
| Smart City |
| Öffentlichen Raum gibt es nicht geschenkt |
| »Auf die Plätze!« |
| »Transcity« |
| Moderne nach Oscar Niemeyer? |
| Form und Funktion der Stadt |
| Funktion und Stadtidentität |
Öffentlichen Raum gibt es nicht geschenkt
Diät und Kontrolle zur Freiheit
von Jürgen MickDie Konkurrenz, die das Internet dem tradierten öffentlichen Stadtraum entgegen bringt, liegt seit den Neunziger-Jahren des letzten Jahrhunderts auf der Hand. Die Veränderungen der Innenstädte sind das eine, die Machtverhältnisse im Cyberspace, die sich reflexartig nach altbekannten Mustern fortsetzen, sollten andererseits nicht verwundern. Lebensverhältnisse ändern sich nicht so rasant wie Techniken. Es muss deshalb anstehen, einen neuen Umgang im virtuellen Öffentlichen zu finden. Es gilt erneut zu klären, wie weit der "Öffentliche Raum" sich in die Wohnzimmer erstrecken darf, und wer wann darüber die Kontrolle haben soll. Es muss offengelegt werden, wer die politischen Fäden im Ernstfall ziehen darf. Hat es doch zu allem Übel den Anschein (und das ist vielleicht die größte Revolution), dass es gar nicht mehr ausschließlich die politisch kontrollierte Macht ist. Das Gewaltmonopol also nicht unbedingt bei den Nationalstaaten liegt. Als Alternativen drängen sich Firmen, Konzerne, Globalplayer und Geheimdienste auf. Das vergegenwärtigt auf drastische Weise: Bürger und ihre Vertreter sitzen auf einmal im selben Boot! (Die beiderseits, ratlosen Minen scheinen bester Beleg dafür.) Wer hat Macht über wen? Eine neue zivilisatorische Vereinbarung steht an, und die erneute Variation im Habitus jedes Einzelnen. Wenn das Internet eine Form des Öffentlichen Raums ist, dann haben wir noch nicht gelernt uns entsprechend zu benehmen. Respekt, Distanz, Vertrauen, Anstand, Reflexivität, Vorsicht des Handelns u.v.m. will uns abverlangt sein.(1) Eine Diät und die Kontrolle zur Freiheit müssen als eine bilaterale Angelegenheit angelegt sein. Die Option zur Machtergreifung muss in die Hände derjenigen gelegt werden, die sich bereit erklären sie nicht anzuwenden. Dazu wird vieles erprobt werden, und nur manches sich erfolgreich erweisen, um der Zumutung des öffentlichen Virtuellen gerecht zu werden. Öffentlicher Raum wird einem nicht geschenkt!
Können wir aus dem "Big Data"-Skandal lernen? - Wie wäre es damit: Das Internet ist ein öffentlicher "Raum"!? Über den Begriff Raum ließe sich tunlichst streiten, aber zumindest öffentlicher, als die meisten gedacht haben, ist das Internet. Erst einmal ist das Netz für jeden zugänglich. Zum zweiten kann jederzeit - wie wir gelernt haben sollten - auch über den "virtuellen Raum" Kontrolle erlangt werden. Und das ist eben von vielen Seiten möglich, sei es durch einen Nationalstaat, einen Geheimdienst oder ein Wirtschaftsunternehmen oder einer Kooperation aus mehreren Akteuren. Die digitalisierte Datenwelt provoziert zur Machtergreifung, Vorherrschaft und Ausbeutung, wie jedes neuartige, zu erschließende Terrain will auch der Cyberspace kartographiert, die Claims ausgesteckt, die Deutungshoheit ausgewiesen sein, analog zu allen vorangegangenen lebensweltlichen Erschließungen. In historischer Abfolge kann man kurz umreißen, das Internet war zuerst die Terra Incognita, dann der Wilde Westen, mutierte zum El Dorado und mit dem Moment da alle Nachzügler angekommen sind, verleitet es zur Manipulation der Masse. Grundsätzlich herrscht in einem leeren Raum selten lange die Anarchie. Die Macht saugt es in jedes Vakuum.
Begleitend hat man die Netiquette entwickelt, zu Scham und Misstrauen aufgefordert, zur Vorsicht bei der Erziehungsarbeit gemahnt und ganz allgemein an den gesunden Menschenverstand appelliert. Die Privatisierung des Internet-Contents durch schonungslose Offenbarung intimster Details ist seit den Anfängen anstößig und, oder gar mit Selbstzensur belegt. Das wandeln durch den Cyberspace ist alltäglicher als der Gang zum Friseur. Wir befinden uns öfter im Datenfluss als auf der Straße. Und es erlegt uns zwangsläufig neue Verhaltensformen auf: Verhaltensformen der Kommunikation. Der aktuelle Umgang mit unseren Bio-Daten ist doch erstaunlich, angesichts der gesellschaftlcihen Übereinkunft einer ärztlichen Schweigepflicht.
Der Streit um das Maß der Veräußerung von Daten jedes Einzelnen und seiner Intimitäten ist nicht allein aus der Opposition von Konservativen (Technik-Skeptizisten und Kultur-Pessimisten) versus Progressiven (Opportunisten und Zukunfts-Optimisten) zurückzustutzen. Die Mechanismen zeigen sich nämlich vor allem bereits bei Bevölkerungsgruppen, denen eine derartige Begrifflichkeit und Differenzierung vollkommen unbekannt ist, die sich in einem instinktiven Entscheidungsprozess hinreißen lassen, sich beobachten zu lassen, und sich hemmungslos als Datenpaket selbst zu versenden: Die Digital Natives. Die Bereitschaft zur Durchleuchtung und Registrierung, die bereitwillige Annahme der Beobachtung ist Äußerung des zum festen Bedürfnis gewordenen Beobachtetwerdens. Die eigene Veräußerung ist zur Stabilisierungspraxis in der Akzeptanz durch die Gesellschaft geworden. Die Selbstversicherung erfolgt heute permanent über den Umweg der Gesellschaft.
Die Gesellschaft basiert schließlich auf dem unit act der gegenseitigen Beobachtung. Seit der Industrialisierung sind wir damit befasst, uns in Form eines Marktwertes bepreisen zu lassen. In Form von Arbeitskraft oder in direktem Marktwert eines Prominenten, eines Stars, eines Sportlers, einer Prostituierten und eines Künstlers. Die Evaluation und der Äquivalententausch machen vor unserer Person nicht halt, sondern sie sind ihr Ziel. Der Anspruch liegt im Austausch gegenseitiger Wertigkeit von gesellschaftlicher Verbrauchbarkeit. Das gegenseitige Beobachten ist mit der industriellen Möglichkeiten massenhafter Warenproduktion überführt worden in ein Evaluierungsverfahren, das sich über Märkte orientiert.(2)
Wir führen im Internet fort, wofür wir lange Zeit den physischen Öffentlichen Raum benötigten. Wie jedes Tauschgeschäft gelingt im Zeitalter des Digitalen der Austausch der Personen(-Daten) im Internet am einfachsten. (Das Gesetz lautet: Alles, was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert werden! Es geht uns selbst betreffend allerdings weniger darum, was wir von uns alles in binäre Codes verpacken können, sondern vielmehr darum, dass wir uneingeschränkt bereit sind, uns auf noch so unterkomplexe Datenpakete reduzieren zu lassen. Evtl. um uns selbst besser in den Griff zu haben.) Der Austausch persönlicher Daten ist eine wesentlich effizientere und umfassendere Methode der Evaluierung, als der prüfende Blick auf der Straße. Auch jedem Bewerbungsgespräch geht eine Suchanfrage via Netz voran. Die Aufmerksamkeitsverteilung kann wesentlich schneller und eruptiver fluktuieren. Man kann Aufmerksamkeit generieren und seinen Körper dennoch zuhause lassen. Während die Schauspielerin noch über den roten Teppich schreitet, verbleibt das Intimste des Videostars verborgen an unbekanntem Ort.
Die Ökonomie der Aufmerksamkeit ist in der Dialektik des Analogen an den Raum gebunden. Objekte, die jedermann zugänglich sind, sind Objekte der Öffentlichkeit. Objekte, die beobachtet werden können und auch beobachtet werden sollen. Eine zweiseitige Prämisse muss erfüllt sein: Erstens müssen öffentliche Objekte so platziert sein, dass sie zugänglich sind. Zweitens muss jedem der Zugang zu dem Ausstellungsort nicht nur theoretisch, sondern physisch praktisch möglich sein. Der wesentliche Unterscheid im virtuellen Medium ist die Maske der Screens. Die Unentdeckbarkeit (für den gewöhnlichen User) gibt vermeintlich Sicherheit. Hier sind wir dem Barock ganz nahe. Erst die Maske bereitet den Weg zur Veräußerung innerer Gefühlswelten. Durch die äußerliche Vereinheitlichung des barocken Mummenschanzes wird das individuelle Private dahinter in Kontrast drastischer erlebbar. So gibt sich das Virtuelle als die potentielle Veräußerung des Intimen zu erkennen. So ist der "User" eine Figur, die uns heute allen Tarnung andient und uns gleichmacht. Wie den Städter auf den Straßen des ancien regime und des 19. Jahrhunderts, als man dazu überging graue Einheitskleidung zu bevorzugen, um nicht aus dem Rahmen zu fallen. Hinter Maske und Camouflage entdecken wir unsere andere Seite als Verlassenheit umso deutlicher. Was wir hautnah zu spüren bekommen, ist die andere Seite der Gesellschaft, sie sitzt oder liegt jenseits der screens, auf dem Bett oder dem Bürostuhl. Als exkludierte Körper bemerken wir uns dann als biologische Fehlkonstruktion, als Mängelwesen zumeist. An denen wir gerne Verbesserungen vornehmen dürfen. Enhancement steht an.
An alle User wendet sich Clay Johnson schon jetzt mit einem Warnhinweis: "Die Folgen einer schlechten Informationsdiät äußern sich nicht im Cholesterinspiegel, sondern in kognitiven Effekten wie Anspannung, Stress, Gedächtnisverlust - oder in der Praxis in Ignoranz. Genauso wie wir bestimmte Nahrungsmittel wie Fett, Salz, Zucker lieben, so reagieren wir auch auf bestimmte Informationsreize positiv. Zustimmung beispielsweise. Menschen gewöhnen sich an salziges Fastfood, aber auch an Informationen, die sie in ihrem Glauben bestätigen." Clay verordnet eine Diät: "... praktisch erfordert das aber eine neue Definition von Bildung. Wenn sich unsere Gesellschaft im Informationszeitalter weiterentwickeln soll, bedeutet Alphabetisierung nicht nur Lesen und Schreiben, sondern auch die Fähigkeit zur bewussten Informationsverarbeitung. Wer in 50 Jahren die Welt der digital vernetzten Computer nicht versteht und sich in ihr orientieren kann, wird als Analphabet gelten. Ich sehe die Gefahr, dass wir weite Teile der Gesellschaft zurücklassen, wenn wir das nicht als grundsätzlichen Bildungsauftrag identifizieren."(3) Was er beschreibt, ist nichts anderes, als das Suchtpotential eines neuartigen gesellschaftlichen Vehikels zur Evaluierung unserer Person, dem ein neu zu erlernendes Verhalten in einem öffentlichen Kontext Not tut. Weil wir andernfalls leiden werden an den Nebenfolgen: An dem uns verbliebenen Selbst. Das sich uns immer unerbittlicher aufdrängt.
Die Gefahr ist aber prompt schon thematisiert, vom Medium selbst: Eine immer schnellere lückenlose Übereignung unserer persönlichen, nun auch physischen Daten, will uns beistehen unser Selbst zu überwinden. Logischerweise kann allein die Überführung der Körper in Daten eine Fortentwicklung bedeuten, hin zu einem restlos inkludierten Individuum. Die Funktionssysteme der Medizin, der Erziehung und des Sports drängen auf Vollinklusion. Die Überführung des Körpers in die Kommunikation steht in Aussicht. Dafür muss garantiert werden, dass alle Versorgungsprobleme gelöst werden. Man arbeitet unter Hochdruck daran. (Google, Apple, Amazon, Facebook, Alibaba, Netflix, NSA, GHCQ, BND um nur die bekanntesten zu nennen.) Es verfügt mittlerweile der größte Teil der Menschheit über einen Zugang zum Internet, zumindest wird aktuell jede Anstrengung unternommen, über kurz oder lang dies zu garantieren. Zu diesem Zweck testet Google zurzeit über bislang unzugänglichen Gegenden unseres Planeten mittels Ballonen die letzten Knoten ins weltweite Netz zu knüpfen. Die vollständige, lückenlose Registrierung ist das erklärte Ziel, und, wie allseits bestätigt wird, die einzige Möglichkeit, wie irgendwann die intelligenten Versorgungssysteme funktionieren können.
Wir sollten dabei im Auge behalten und davon ausgehen, dass all die Dinge, die dort geschehen, und die Daten die man hier aufsammelt so öffentlich sind, als passierten sie auf offener Straße. Einer Straße, auf der sich eine Weltöffentlichkeit zeigt und beobachtet. War einst der Raum das Medium der Öffentlichkeit, so sind es jetzt die Server, die wir das Netz nennen. Das Netz ist kein dialogisches Medium. Auch wenn es sich hartnäckig darin versucht, sich diesen Anschein zu geben. Der Adressat aller Netzkommunikation ist eine virtuelle Gesamtheit, die einer Cyber-Öffentlichkeit. Das Motto lautet per definitionem: Alle lesen! Und am besten potente Organisationen. Die E-Mail ist die Postkarte des Cyberspace. Sie wird symptomatischer Weise schon jetzt zum obsoleten Medium. Soziale Netzwerke, Blogs und Kommentarplattformen sind ihre Nachfolger und darauf angelegt follower & friends zu generieren. (Auch diese Begriffe bedürfen einer Entschlüsselung und der Entkopplung von ihrer etymologischen Herkunft) Wie im physischen Öffentlichen Raum, stehen unzählige Adressaten einer schier unerschöpflichen Aufmerksamkeitskapazität zur Verfügung. Die Masse steht allzeit bereit.
Wie auch der Beobachtete nicht alle seine Beobachter kennen kann, kann der Beobachter nicht alles im Blick haben. Man kann sich passiv durchs Netz zappen ohne eine Kommunikation anzuzetteln, man kann jederzeit auf sich aufmerksam machen, oder man kann es beim Beobachten belassen. Allerdings "anwesend" ist man dennoch immer. All dies liegt im Bereich des Möglichen all derer, die das Netz nutzen. Das erinnert nicht nur entfernt an die Bewegung in einem urbanen Kontext. Wir sehen uns in dieser Analogie einem Medium ausgesetzt, das damit unerfahrene Menschen mit Sicherheit genauso in Konzentration, Aufmerksamkeit und Kontrolle beansprucht, wie der Eintritt ruraler Bevölkerungen in urbane Lebensverhältnisse. Die "Erfindung" des Öffentlichen Raums verlangte den Menschen unvermittelt einen neuen Habitus ab. Eine verfeinerte, sensibilisierte Umgangsweise musste erprobt, erlernt und etabliert werden. Weil es deutlich wurde, dass es einer Zumutung gleichkommt, wenn man im öffentlichen Raum all die Dinge tut, die man persönlich für wichtig oder auch unwichtig hält. Man musste den Spieß umdrehen. Man erklärte alles, was im öffentlichen Raum geschieht, als grundsätzlich für die Augen des anderen bestimmt! In der Folge sollten alle dort nur tun, was dieser Zumutung gerecht werden kann. Dies könnte man den Imperativ des Öffentlichen bezeichnen. Man lernte unter dieser Prämisse vor allem das Wegsehen! Aber auch das Sich-bedeckt-halten. Ebenso könnte es ein neues Bewusstsein wecken, wenn man den Datenfluss im Netz als grundsätzlich für alle bestimmt einordnen würde.
Selbstbeschränkende Macht
An dieser Stelle interessieren im Moment vor allem die vorherrschenden Machtverhältnisse. Dabei bemerkenswert - im historischen Rückblick-, dass sich im Idealfall dem Imperativ des Öffentlichen tatsächlich sowohl "Untertanen", als auch die "Mächtige" unterwarfen. Die Macht "erlernte" das "Absehen", spätestens als sie begriff, dass Freiheit (der Untertanen) produktiv sein wird und jede Gesellschaft befördert. Auch wenn potentiell "die Macht" jederzeit das "Hausrecht" über den Öffentlichen Raum inne hielt und behaupten kann, steht zuerst der Öffentliche Raum in der Absicht der Freiheit jedermann zur Verfügung. Alles dies ist mit dem Aufkommen des Öffentlichen in den Anfängen der Urbanisierung probiert und etabliert worden.Man hat im Netz zu entscheiden, was man veröffentlicht, ein Recht darauf, nur das zu zeigen, was man will, ebenso wie eine Pflicht, nur das zu zeigen, was gesehen werden soll. Mit dem jüngst juristisch eingeforderten "Recht auf Vergessen" ist beispielhaft eines der jüngsten Gerichtsurteile der öffentlichen Form des Netzes gerecht geworden. Vorsicht ist deshalb immer geboten, weil auch der Cyberspace als ein "neuer Raum", ebenso zwanghaft unter Kontrolle gebracht werden will, wie jeder andere Flecken in unserem Universum. Öffentlicher Raum ist per definitionem machtfreier Raum, wenn auch nur in geliehener Form oder temporär. Aber keineswegs a priori gegeben; sondern gleichsam hinein geschlagen in den Dschungel von Machtverhältnissen.
Als eines der Urtraumata kann das Drama vom 4. Juni.1989 am Tiananmen-Platz in Peking bezeichnet werden. Es ist ein derart kräftiges Exempel, weil es bezeugt, dass die gewaltsame Machtergreifung über einen Öffentlichen Raum sogar in einer ausgewiesenen Diktatur, einen nicht hinzunehmendem Tabubruch bedeutet. Ein derartiges Verständnis muss entsprechend für den Cyberspace noch entwickelt werden. Vielleicht ist das Bewusstwerden von "Big Data" eine ebensolche Chance einzusehen, wie kostbar die Errungenschaft des Öffentlichen Raums im Netz für unsere Freiheit ist. Wenn uns nicht vorher das Gespür dafür verloren geht, wie fragil die erteilte "Erlaubnis" zu offen gelebter Kommunikation ist. Die Bilder von den Plätzen dieser Welt zeigen uns täglich verschrobene Verhältnisse dieses Gleichgewichtes und belegen gleichzeitig, dass Freiheit zwar als ein Grundrecht definiert ist, in Räumen, die man jederzeit als rechtsfrei deklarieren kann, aber nicht unbedingt realisiert wird. Für den Rechtsstaat kämpfen derzeit viele Menschen auf den Straßen und Plätzen ihrer Städte.
Die Art der Restriktionen politischer Macht bestimmt die Freiheitsgrade der Bevölkerung. Ein politisches System definiert sich über die Option zur Kontrolle der Macht. Wir verfolgen es täglich in aller Welt, wenn in Städten die Straßen und Plätze von Ordnungskräften und Staatstreitmächten geräumt werden. Wenn Wasserwerfer und berittene Polizisten zwischen Demonstranten ihre Schneisen pflügen. Nur die Option zum Ergreifen der Kontrolle nicht auszuüben, signalisiert wirkliche Macht und sichert gleichzeitig Freiheit. Man beobachtet aus genau diesem Grunde, wie vor allem in Fällen des Schwindens von Macht reflexartig mit der Verschärfung der Kontrolle des Öffentlichen reagiert wird. Voraus geht der Versuch der Manipulation der öffentlichen Meinung, die Besetzung von Radio- und Fernsehstationen, neuerdings die Zensur und das Hacken von Servern. Der Zugriff auf die öffentlichen Plätze ist dann der letzte Prankenhieb der Mächtigen, die ihr Ende kommen sehen. Ein Öffentlicher Raum ist eine fragile Angelegenheit.
Es sei ein Irrtum, sagt der Politikberater Simon Anholt, dass das Internet als freier Kommunikationsraum automatisch zu mehr Freiheit führe: "Weil es frei ist, ist es eben nicht immun gegen Manipulation."(4) Oder umgekehrt: Weil es Manipulationen offen steht, zeigt es an, dass es prinzipiell frei ist von Herrschaft, also Qualitäten einer Öffentlichkeit aufweist. Es war jedenfalls eine naive Annahme, wenn je jemand geglaubt hat, das Internet wäre ein freier und gleichzeitig privater Raum für alle. Das wäre so kindisch, als hätte man geglaubt, der Wilde Westen wäre die manifestierte Freiheit auf Erden. Es war nur temporär spärlich besiedeltes Terrain, in dem sich Desperados austoben durften und jeweils nur der schnellere und der stärkere von ihnen überlebte. Im Wesentlichen war es ein rechtsfreier Raum, der kurzzeitig zum Missbrauch einlud, was sich äußerst blutig zurechtrückte.
Zu glauben, dass man in den öffentlichen Datenverkehr private Tunnel graben könne, die gewappnet seien gegen Veröffentlichung, ist und war nicht mehr als Gutgläubigkeit in wohlmeinenden Zeiten der Expansion und des Aufbaus. El Dorado ist ein Phantom. Über jeden Raum müssen die Beherrschungsverhältnisse verhandelt werden.Man spricht auch im Netz von "Geheimtüren" und "Losungen" und begreift erst jetzt, dass es hier gilt Besitzstand und Machtverhältnisse zu sichern und zu ordnen. Das erinnert an die Geheimtüren der Geschichte. Die versteckten Schlupflöcher und Gänge, die den Mächtigen im Ernstfall das Leben und ihre Macht retten sollten. Für den Fall, dass die öffentliche Stimmung auf dem Platz vor dem Palazzo kippte und ihm der Fluchtweg abgeschnitten wäre. Ebenso wenig kennt man einen wirklich öffentlichen Raum unter diktatorischen Machtverhältnissen, der diesen Namen verdiente. Dort gehören die Zensur und die Kontrolle über "öffentliche Räume" zum Werkzeugkasten des Regimes (siehe Tiananmen-Platz). Die Macht und der freie Öffentliche Raum stehen in einem paradoxen Verhältnis der freiwilligen Nicht-Kontrolle, das man unter dem Paradox von der "Kontrolle zur Freiheit" verbuchen muss.
17.09.2014
| (1) Siehe Han, Byung-Chul, Im Schwarm. Ansichten des Digitalen, Berlin 2013 |
| (2) Kolossowski, Pierre, Die lebende Münze, Berlin 1998 |
| (3) Clay Johnson im Interview mit Johannes Kuhn: "Wir erleben eine neue Form der Ignoranz", SZ-Online.de, 30.01.2012 |
|
(4) Anholt, Simon in: Hans, Julian, Putins Trolle, SZ-Online.de, 13.06.14 |
| LESEN SIE AUCH | ||
| Auf die Plätze! | ||
| * | ||
| Jetzt-zeichnen-AG | ||
| anteil (at) jetzt-zeichnen-ag.de | ||